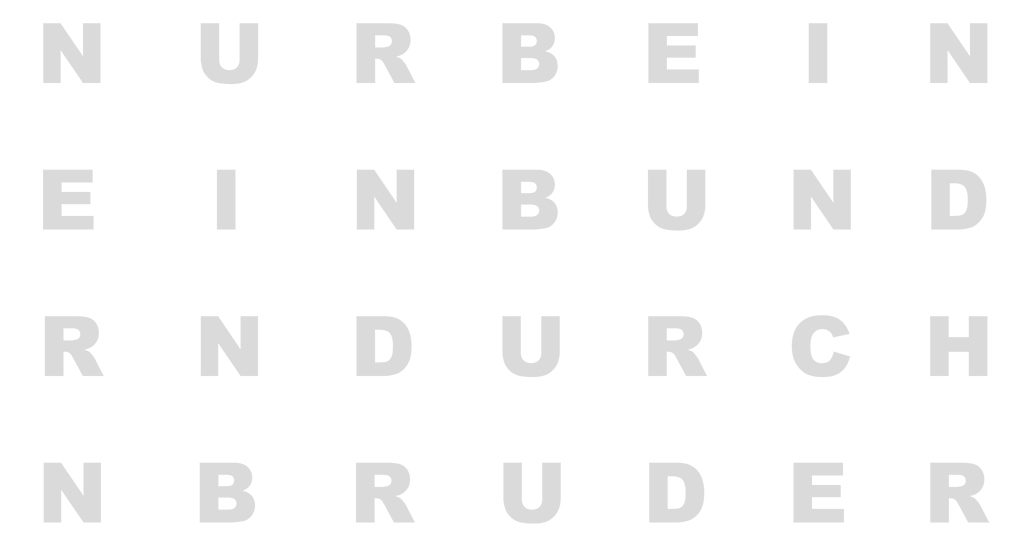Vom Schreiben für Jugendliche zum Schreiben für (auch) Erwachsene
Als Medium hat das Buch es gegenüber den visuellen und akustischen Medien auch und vor allem deshalb schwer, weil Lesen längst eine Zumutung darstellt.
Es handelt sich bei diesem Text um eine Rede von Andreas Steinhöfel, welche er im Jahr 2008 anlässlich des Welttags des Buches im Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule FHNW gehalten hat. Wir veröffentlichen den Text mit freundlicher Genehmigung des Autors in leicht gekürzter Form.
1. Lesen und Lesebedürfnis
Unsere Jugendlichen lesen ja nicht, von sich aus lesen die ja nicht! Als Autor auf Lesereisen hört man diese Klage oft. Eigentlich hört man sie ständig, meist in Lehrerzimmern, weniger häufig in Bibliotheken. In der Regel schließt sich als nächster Satz die Aufforderung an: Schreiben Sie doch mal was, das unsere Jugendlichen zum Lesen bringt! (Das klingt nicht nur dumm, das ist es auch. Als nächstes schreiben wir ein Buch, das endlich den Weltfrieden herstellt). Schreiben wir also für Jugendliche, auf dass sie endlich wieder lesen. Die aus solchem Wunschdenken sprechende Gewissheit dass
A. Lesen gut ist für den Menschen und
B. der Autor sich als moralischer Kollaborateur betätigen muss, um all das Gute unters Volk zu bringen, wird an Naivität nur noch durch die Überzeugung übertroffen,
C. der Jugendliche sei per se zum Lesen bestimmt.
Glauben Sie mir, meine Damen und Herren: Kaum etwas liegt dem durchschnittlichen Jugendlichen, sofern hormonell bei ihm alles mit rechten Dingen zugeht, ferner als das. Aber es gibt, natürlich, Ausnahmen. Der vor Ihnen stehende Autor zum Beispiel verbrachte seine Jugend tatsächlich, zu einem guten Teil, lesend. Allerdings bestand die Lektüre, zur Verzweiflung seiner Deutschlehrer, aus den so genannten „Groschenheftchen“: Jeweils 64 Seiten süßesten Vergnügens; speziell waren es die Heftchen aus den Sparten Horror und Science Fiction. Der Dämonenkiller und Perry Rhodan erschienen ihm ungleich wichtiger, literarisch wertvoller und seinem Weltempfinden näher, als alles, was ein Heinrich Böll oder Günther Grass je hätten schreiben können.
Über die Lektüre trivialen Schunds gelang es dem Autor in spe nicht nur, seine pubertären Allmachtphantasien geistig auszuleben, sondern auch die von ihm empfundene Ohnmacht gegenüber einer erwachsenen Welt zu sublimieren – indem er ihr schlicht und ergreifend entfloh. (Hier ist nicht der Ort, dies im Detail auszuführen, doch über das Groschenheft lernte ich tatsächlich, dass das geschriebene Wort ein Leben retten kann.) Damals kannte ich sogar Leute, die überhaupt nicht lasen. Sie tun es heute noch nicht und führen doch, so weit ich das überschauen kann, ein erfülltes, wenn nicht glückliches Leben. Lernen wir also zunächst, den Ball ein wenig flacher zu halten – ein Rückgang an jugendlicher Leserschaft (wie er Jahr für Jahr im Vorfeld der Buchmessen immer wieder behauptet wird, statistisch dann aber doch nicht belegt werden kann), ein Rückgang an Lesern also läutet noch lange nicht den Untergang des Abendlandes ein. Und dass wer liest automatisch der bessere Mensch ist, glaubt sowieso keiner mehr, schließlich liest auch der durchschnittlich skandalbelastete Politiker gern mal ein Buch, so mancher schreibt sogar eines; das bedeutet also gar nichts.
Dennoch könnte man, lauscht man dem Wehklagen, beinahe glauben, es gäbe eine Art natürliches, dem Menschen quasi eingeborenes Lesebedürfnis. Nur dass es diesem Lesebedürfnis gegenwärtig nicht mehr so recht gelingen will, dem Zeitgeist zu trotzen. Gehen wir spaßeshalber einmal davon aus, dieses natürliche Lesebedürfnis unter Jugendlichen existierte tatsächlich: Wer entscheidet dann darüber, wie dieses Bedürfnis gestillt wird? Und zu welchem Zweck überhaupt? Damit aus der Welt ein besserer Ort wird? Oder damit Autoren, Verleger und der ganze literarische Dienstleistungsbetrieb sich die Taschen füllen können? Denn genau das sind die Pole, zwischen denen die Kinder- und Jugendliteratur (und nicht nur diese) sich bewegt: Kommerz und Anspruch. Wobei Kommerz böse ist und Anspruch gut, die biestige Zielgruppe der Jugendlichen das aber genau andersherum sieht, was schon Platon in Rage brachte und mir heute zu der Ehre verhilft hier zu stehen.
Ich erinnere sehr gut den Satz eines Jugendlichen, nachdem im Herbst 1999 der Deutsche Jugendliteraturpreis für das beste Kinderbuch an Annika Thors Eine Insel im Meer ging: O Mann, schon wieder dieser Scheißholocaust! Tschuldigung, aber die prämieren auch immer denselben Mist!
Den ersten politisch korrekten Schrecken auf einen solchen Satz außer Acht gelassen, drückt sich darin eine recht banale Wahrheit aus: Wir Erwachsenen hatten es mal wieder geschafft. Einmal mehr hatten wir das gute Buch erkannt und würden es jetzt, versehen mit dem goldenen Gütesiegel, seiner Zielgruppe, also den Opfern unserer Wahl, aufs Auge drücken. Denn im Gegensatz zu uns Erwachsenen wissen die Jugendlichen einfach nicht, was gut für sie ist. Deshalb schreiben wir ihnen ihre Literatur. Vor.
2. Autor und öffentliche Wahrnehmung
Vom Schreiben für Jugendliche zum Schreiben für (auch) Erwachsene: Der Überschrift zu diesem Redebeitrag liegt ein Bild zugrunde: Das des Autors, der aus den literarischen Niederungen der Kinder- und Jugendliteratur mit zum Himmel gestreckten Armen nach oben aufsteigt in die weihevollen Hallen der Belletristik, per aspera ad astrum. Mag sein, dieses Bild entspringt einem persönlichen Minderwertigkeitskomplex – das wäre dann allerdings einer, den ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen teile; ich werde darauf zurückkommen. Tatsächlich ist es, hört man sich um, ein beinahe landläufiges, dieses Bild vom Autor, wie er sich von unten nach oben gearbeitet hat, vom Kinderbuch zum belletristischen Roman. Ärgerlich ist es allemal. Es besteht da offensichtlich eine gewisse Schieflage in der gegenseitigen Wahrnehmung: Während die Belletristik uns nicht zutraut, auch für Erwachsene schreiben zu können, wissen wir Kinder- und Jugendbuchautoren längst, dass jeder Idiot einen durchschnittlichen belletristischen Titel hinlegen kann. Wir wissen um die kniffelige Magie verknappter Sätze, um die (oft zerstörerische) Verwandlung von Inhaltlichem in Wesentliches, die unsere Lektoren von uns fordern. Wir kriegen es ab, in erster Reihe, wenn randalierende Achtjährige eine Lesung platzen lassen, weil wir sie nicht alle fünf Sätze mit einer neuen Pointe überraschen konnten … während dem Kollegen aus der Belletristik leise und unbemerkt die Leute wegschnarchen.
Es ist eine schlichte, vielen unter Ihnen längst bekannte These: Die Werke des Kinder- und Jugendbuchautoren stehen im öffentlichen Ansehen bestenfalls so hoch, wie das Publikum, für das er sie schreibt. Ich wiederhole diesen Satz, damit sich Ihnen sein ganzer Schrecken erschließt: Die Werke des Kinder- und Jugendbuchautoren stehen im öffentlichen Ansehen genau so hoch, wie das Publikum, für das er sie schreibt.
So etwas kann nicht ohne Folgen bleiben.
Natürlich gibt es sie auch unter den Kinder- und Jugendbuchautoren, jene Schreiber, die sich selbst für die Retter des Okzidents halten und ihre Bücher für die Antwort auf alles noch offenen universellen Fragen; doch stellen sie, Gott sei Dank, nicht die Mehrzahl. Nein, eher ist es umgekehrt: In der Regel ist das Selbstbild des Kinder- und Jugendbuchautoren beschädigt, mitunter nicht unbeträchtlich. Es erhält seine Schrammen durch wiederholte narzisstische Kränkungen, und die wiederum kommen durch Unterhaltungen wie diese, meist mit Zufallsbekanntschaften, zustande:
Und was machen Sie beruflich?
Ich schreibe.
Bücher?
Ja. Für Kinder und Jugendliche.
Ach! So was wie Harry Potter?
Nein.
Gedichte?
Nee. Ganz stinknormale Geschichten.
Ach ja. Hm … Ja, kann man denn davon leben?
Sehe ich irgendwie tot aus?
Ha ha … Wissen Sie, ich hab ja auch ein Kinderbuch geschrieben. Für meine kleine Nichte.
Bei wem?
Bei mir zu Hause.
Ich meine, bei wem wurde es verlegt?
Ach, verlegt … Gar nicht, gar nicht.
So.
Ich meinte ja auch nur. Ich will damit sagen, so ein Buch zu schreiben, das ist ja nicht schwer, gell. Phantasie muss man halt haben, ja, das ist schwer, aber das Schreiben selbst, na, das muss ich Ihnen nicht erzählen, das wissen sie selbst. Sie schreiben ja auch.
Kinder sind, folgt man der Logik derlei sachkundiger Ausführungen, leicht zu unterhalten. Irgendeine dumme, kleine Geschichte vom sprechenden Kleiderschrank reicht aus, sie glücklich zu machen oder des Abends wenigstens sanft einzuschläfern; man muss dazu nicht mal ein Buch kaufen, sondern man schreibt es selbst! Kinder sind, dem Herrn sei’s getrommelt, einfach wunderbar blöde, und diese Haltung, meine Damen und Herren, ist die Strafe Gottes für VHS-Kurse in kreativem Schreiben.
3. Jugendliteratur und ihre Vermittler
Jugendliche sind ungleich anspruchsvoller als Kinder. Anders als das Kind, dem der sprechende Kleiderschrank ausreichen mag, sucht der Jugendliche in seiner Literatur ganz bewusst nach mal mehr, mal weniger psychologisch komplexen Identifikationsangeboten. Und was findet er? Eigens für ihn verfasste Lektüre, mit den besten Absichten. Bücher zu Themen wie AIDS, Alkoholismus und Inzest, zu ungewollter Schwangerschaft, zum frühzeitigen Ableben von Eltern oder Beziehungspartnern, zu Homosexualität, Obdachlosigkeit, Sekten, Rechtsradikalismus, Autismus, zu etlichen körperlichen oder geistigen Behinderungen, zu Magersucht, Kleptomanie, Drogen und Okkultismus … kurz: zu allem, was einem Jugendlichen bei eingehender Lektüre gründlich die Laune versaut, vorgeblich aber doch, glaubt man dem Buchmarkt, sein junges Leben bestimmt. Auch wenn diese Aufzählung sich eher liest wie der Kriterienkatalog für eine vom Aussterben bedrohte Spezies.
Beruhigen wir uns: Selbstverständlich macht diese Art der Jugendliteratur nicht mehr das Gros der alljährlichen Produktion aus – wenigstens hoffe ich das. Denn was sich hier immerhin eine ganze Generation während als Jugendliteratur tarnen durfte, das war in Wirklichkeit oft kaum mehr als in Prosa gefasste Lebenshilfe. Dieses Phänomen hat einen historischen Hintergrund, an dem zunächst so wenig auszusetzen ist wie an Lebenshilfe an und für sich. Aber es sei die Frage erlaubt, ob man diese Art von Problembewältigung nicht jenen überlassen sollte, die sich seit jeher gut damit auskennen, BRAVO und Dr. Sommer zum Beispiel. Und das meine ich ganz ernst. Es ist kein weiter Schritt von der guten Absicht zur Bevormundung.
Nein, es gibt sie natürlich längst, die neue Jugendliteratur, die diesen bemühten Pädagogenmuff abgeschüttelt hat. Sie kam aus Skandinavien und über den großen Teich, wir deutschsprachigen Autoren mussten nur wieder ein wenig länger warten, bis die Kritiker sie uns imitieren und unsere Lektoren sie uns durchgehen ließen. Doch selbst mit nach vorn gerichtetem Blick auf ein emanzipiertes, der Belletristik gleichberechtigtes, dem banalen wahren Leben viel näheres Jugendbuch bleibt immer noch ein Problem:
Wie selbstverständlich sprechen wir von den sogenannten Vermittlern der Kinder- und Jugendliteratur. Wenn im Vergleich des Schreibens für Erwachsene und dem für Jugendliche etwas lohnt, dann eine Aufzählung all jener Zwischeninstanzen, die ein Buch auf seinem Weg aus der Feder des Autors bis hin zum Jugendlichen zurücklegt. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass jede einzelne der nun folgenden Etappen für eine eigene Meinung, für einen Menschen mit ureigenen Kriterien steht bezüglich der Frage, was gut ist für den jugendlichen Leser. Als da wären:
– der Autor
– der Lektor
– der Verleger
– der Außenhandelsvertreter
– der Buchhändler
– der Bibliothekar
– der Kritiker
– und nicht zuletzt der Käufer des Buches; in der Regel irgendein Wesen mit Erziehungsgewalt, also Eltern oder Lehrer.
Der von sich aus lesende Jugendliche, unser eigentlicher Adressat also (der in dieser Liste allerdings nicht auftaucht), zuckt anbetrachts des Aufgebots an besserwisserischem Personal bloß mit den Achseln und pfeift sich wahlweise Harry Potter oder die Elementarteilchen rein; er vergnügt sich heute mit Stephen King und morgen mit Umberto Eco. Ihm ist schnurz, ob ein Science Fiction-Autor Stanislav Lem oder Terry Pratchett heißt, weil er weiß: Je größer die Bandbreite der von ihm gelesenen Werke, je besser er sich auskennt zwischen Kunst und Kommerz, umso reicher und beglückender sind seine Leseerlebnisse. Und zwar in beide Richtungen. Die Literatur für Jugendliche existiert längst. Sie ist teils speziell für sie verfasst, teils für die Erwachsenen, zu denen sie bald gehören sollen, doch wen schert‘s überhaupt? Wir müssen unsere Leser nur in Ruhe lassen. Sollen sie doch lesen, was ihnen gefällt. Wo ist das Problem?
[Kapitel 4 wurde aus Platzgründen weggelassen]
5. Intelligenz und Konsequenz
Lesen verströmt, unter allem hektischen Flitter und Flimmer unseres jungen, neuen Jahrtausends noch immer seine uns so vertraute Aura von Ruhe, von innerer Einkehr und Gesammeltsein. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass so mancher unter uns das Buch und das Lesen immer vehementer zu verteidigen versucht. Die schöne neue Welt ist unser Feind, um uns herum wimmelt es von Ignoranten, die sich mit dem Blick auf glitzernde Oberflächen zufrieden geben, für die leicht zugängliche Inhalte gefragt sind, sie sind, am besten multimedial aufbereitet, bunt, laut, schnell geschnitten im Cliprhythmus der Musiksender. Die Verlage, wird konstatiert, machen dieses Spiel fröhlich mit, keiner will der letzte sein, keiner den Anschluss verpassen beim Verzahnen von PC und Internet mit TV und mit Buch … und doch stoßen sie mit all ihren Bemühungen letztlich immer wieder nur auf den Leser, der ohnehin schon liest. Bedeutet all dies, dass der Rest vor allem der nicht lesenden Jugend unrettbar verloren ist? Verblödet?
Im selben Maße, in dem Kinder und Jugendliche für geistig so beschränkt oder minderbemittelt gehalten werden, dass man ihnen Literatur wie Medizin verabreichen muss – das Buch als Heilmittel gegen den inzwischen schon bald mythischen Werteverlust – im selben Maße ist auch der Autor angesehen, der für diese Jugendlichen schreibt: Der Einäugige unter den Blinden. Um das kurz, und deutlicher als zu Beginn meines Vortrages, zu belegen: In einer Diskussion über die postmodernen Anteile in meinem Roman Die Mitte der Welt zeigte ein Lehrer sich gleich zweifach erstaunt: Zum einen über mein Wissen um die Techniken und Inhalte postmodernen Erzählens. Zum anderen mit der Feststellung, das sei doch ein bisschen Perlen vor die Säue geworfen, die Jugendlichen würden das doch ohnehin nicht verstehen. Das mag zutreffen oder auch nicht. Aber soll man Fragesteller wie diesen Herrn, nur weil sie die chemische Zusammensetzung der von ihnen geatmeten Luft nicht aufsagen können, deshalb gleich erwürgen? Oft genug in solchen Fällen ist einem ja danach …
Was also will man solchen Menschen erwidern? Dass das einzige, was wir Erwachsene den Jugendlichen tatsächlich voraus haben, ein wenig mehr an Lebenserfahrung ist, ein viel mehr an Desillusionierung und der schleichende Verlust nahezu all unserer Träume? Die traurige Tatsache, dass wir lediglich besser gelernt haben, unsere Unsicherheiten zu kaschieren? Worauf sind wir eigentlich so stolz?
Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass jeder Jugendliche (oder, was das angeht, jeder Jugendbuchautor) von Haus aus ein intelligenter, witziger Mensch ist. Ich habe auf meinen Reisen Kollegen getroffen, die sich besser auf das Schreiben von Kochbüchern verlegen sollten, und ich habe mit Jugendlichen zu tun gehabt – immer wieder und nicht mit wenigen – die über nur noch rudimentäre Ansätze eines Gehirns zu verfügen schienen und die ich, mit Verlaub, in einem beliebigen TV-Container unter laufender Kameraüberwachung oder bei den zynischen Superstar-Castings besser aufgehoben wüsste als ausgerechnet bei einer Autorenlesung.
Und womöglich, das sage ich ganz ohne Häme, würde ein solcher Ortswechsel sogar in bestem beidseitigem Einverständnis erfolgen. Wer hat je verfügt, der allseits lesende und belesene Jugendliche sei das Ziel aller erzieherischen Gewalt? Lesen oder gar einem Vorlesenden zuzuhören ist nun mal weiß Gott nicht jedermanns Sache, und das Phänomen der Zwangsentsendung von Schülern zu Lesungen, wo ihnen auch mal ein bisschen ein Buch nahe gebracht werden soll, ist einzigartig in unserer Kulturlandschaft. Effektiver kann man einem Menschen eigentlich das Buch, das Zuhören, das Lesen nun wirklich nicht vermiesen.
Nein, unser Problem ist weder eine fehlende Literatur für Jugendliche, noch sind es die Jugendlichen selbst. Das Problem ist auch nicht mangelnde Ansprache dieser Zielgruppe oder deren schlichtes Desinteresse am Buch. Unser wirkliches Problem ist der kulturelle Reflex, dass wir nur ungern wahrnehmen, wie unter einem größer gewordenen Angebot an Zerstreuungsmöglichkeiten das Buch, dieser einst so mächtige Wissens- und Werteträger, in der Beliebtheit bei vielen Jugendlichen auf die hinteren Plätze rutscht. Es gibt heute ein ungleich größeres Aufklä- rungs-, Informations- und Unterhaltungsangebot als noch vor zehn Jahren … wobei dem Buch, nur war das seinerzeit in aller Tragweite noch nicht absehbar, bereits mit dem ersten Daumenkino eine mächtige Konkurrenz erwachsen war. Inzwischen droht es, lauscht man Kritikern wie Neil Postman, vom digitalen Bildersturm hinweggefegt zu werden.
Als Medium hat das Buch es gegenüber den visuellen und akustischen Medien auch und vor allem deshalb schwer, weil Lesen längst eine Zumutung darstellt. Es gibt zwar noch ausreichend Menschen, die tagtäglich ihren Intellekt bemühen – und ich gehe mal davon aus, dass es immer genug solcher Menschen geben wird – doch der Durchschnittsbürger verrenkt sich das Hirn gerade mal um die halbe Drehung, die es benötigt, um nach Antworten auf die Fragen aus den Schwachsinnskatalogen einer beliebigen Fernseh-Quizshow zu suchen … wenn überhaupt. Doch genau hier wäre der Ansatzpunkt zu finden für Kritik wie für Veränderung: Wir müssen fortkommen von einer Kultur der Beliebigkeit und der schnellen Bilder, der Oberflächenreize und Undurchdachtheiten. Wenn Lesen tatsächlich eine Zumutung darstellt, liegt es dann nicht nahe, dass den Menschen – nicht nur den jungen – einfach wieder mehr zugemutet werden muss?
Merkwürdig, dass viele Autoren und viele Verlage genau dies nicht mehr zu wagen scheinen. Was vielleicht daran liegt, dass unter dem Deckmantel politischer und sozialer Korrektheit sich längst eine Kultur der Trägheit und der Beliebigkeiten entwickelt hat, eine Kultur der Beliebigkeit auch und vor allem im Miteinander. Dieses oder jenes vereinzelte Schreckensbild vermag uns vielleicht noch kurz aus dem Fernsehsessel nach vorn zucken zu lassen, aber so richtig kriegt den Hintern dann doch niemand mehr hoch. Wie auch, wenn uns tagtäglich vorgeführt wird, dass politisch unsinniges, moralisch verwerfliches oder kriminelles Handeln kaum noch oder keine Konsequenzen hat.
Dazu kommt, dass die Welt auf der anderen Seite der Mattscheibe sehr viel transparenter geworden ist. Dank der Aggressivität der Nachrichtenkanäle, dank der schrillen Töne sich für Belanglosigkeiten prostituierender Moderatoren und Redakteure ist ihr Wahnsinn greifbarer, sichtbarer, wenn dadurch auch nicht nachvollziehbarer geworden – er brennt nur intensiver als früher, so dicht liegt er inzwischen auf unserer Haut. Selten waren die Menschen der westlichen Hemisphäre so untereinander konform und uniform wie heute, unter den alles vereinigenden Bannern Banner von VIVA und MTV, von Levis und DKNY oder, was das Buch angeht, von Amazon und Harry Potter. Selten war der Jugendliche dermaßen cool, selten war er dabei so offensichtlich verletzlich wie heute … bloß will von seiner Verletzlichkeit in zehn Jahren niemand mehr etwas wissen.
Es braucht mehr als Bücher, um solche Entwicklungen abzuwenden. Und lassen Sie uns bitte eines nicht vergessen: Wir können ein Kind einhundert pädagogisch wertvolle Bücher, wahlweise auch einhundert Groschenheftchen lesen lassen – nichts davon macht es zu einem aufrechten und aufrichtigen Menschen, wenn wir glauben, damit sei alles getan. Kein Buch kann eine tröstende Umarmung ersetzen oder ein Gespräch: Liebe und Respekt lassen sich nicht erlesen.
Zum Abschluss einige Wünsche:
Wir Autoren sollten uns, ohne jeden Hochmut, als Künstler begreifen, uns also einer Vision mehr verpflichtet fühlen als dem Geldbeutel oder der Frage nach unmittelbarer Lesbarkeit. Dennoch sollte der Geldverdiener ebenso wenig geschmäht werden wie der im Aufklärungsstil schreibende Pädagoge. Lernen wir, lässiger miteinander umzugehen. Das bin ich dem Kerlchen, das die Groschenhefte gelesen hat, schuldig.
Unsere Verleger müssen, damit stimme ich in eine wohl bekannte alte Klage ein, mehr Wagemut zeigen, in jede Richtung: Werdet anspruchsvoller; werdet trivialer.
Unsere Lektoren wären gut beraten, wenn sie uns Autoren mal ein, zwei Nebensätze mehr durchgehen ließen. Syntaktische oder thematische Komplexität hat noch niemanden umgebracht, und für Wenigleser wird bereits genug geschrieben. Wir sollten anspruchsvollen Leser nicht mit Inhalten beleidigen, die sich an bei Sozialtherapeuten abgekupferten Gebrauchsanweisungen für Adoleszente orientieren.
Einige Kritiker täten gut daran, Rezensionen für das lesende Publikum zu verfassen anstatt zur Bespiegelung ihrer durch jahrelanges Literaturstudium erworbenen Wissens. Einige andere täten gut daran, ein paar Jahre lang Literatur zu studieren.
Alle übrigen Vermittler könnten sich ein wenig mehr Zurückhaltung auferlegen. Besserwisser von Berufs wegen machen sich unbeliebt.
Quod erat demonstrandum.
© Andreas Steinhöfel, Berlin 2001/2003

Andreas Steinhöfel wurde 1962 in Battenberg geboren. Er studierte Anglistik, Amerikanistik und Medienwissenschaften in Marburg. Heute arbeitet er als Übersetzer, Rezensent und Drehbuchautor – vor allem aber ist er ein vielfach preisgekrönter Kinder- und Jugendbuchautor. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen z. B. »Rico, Oskar und die Tieferschatten«, für welches er 2009 den deutschen Jungendliteraturpreis erhielt oder »Die Mitte der Welt«, welches verfilmt wurde und dieses Jahr noch in die Kinos kommt.